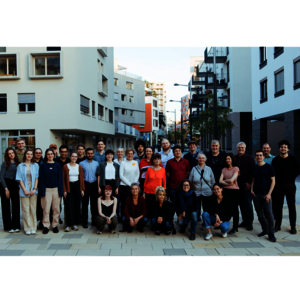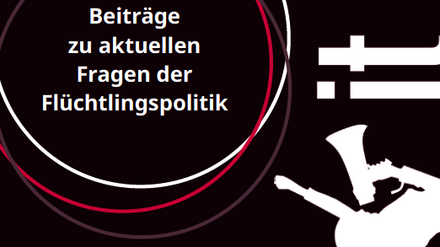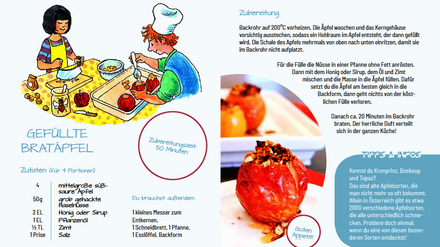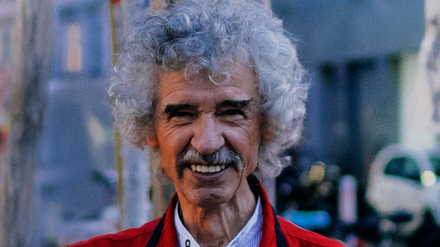Generalversammlung der GBW Wien, 11.April 2024
Allgemein
Holy Prostitution – Film und Gespräch
Über die systematische Unterdrückung von Frauen im Iran.
Allgemein
Act Now! Klimakonferenz
Mit über hundert Teilnehmer:innen pro Tag, diskutierten wir über die Zukunft.
Allgemein
Zweite Feministische Klimakonferenz
Fulminant ging die 2. Feministische Klimakonferenz mit vielen Expertinnen, Aktivistinnen und Politikerinnen am Samstag im Wiener Rathaus zu Ende.
Allgemein
Politik auf dem Teller
Konstruktive Beiträge zu einer globalen Ernährungswende
Allgemein
Willkommen neuer Vorstand
Wir präsentieren unseren Vorstand für die Funktionsperiode 2023-2025
Allgemein
Say it loud!
Beiträge zu aktuellen Fragen der Flüchtlingspolitik
Allgemein
The Green Line – Die Zweierlinie als Jahrhundertchance
Vision einer lebenswerten Zweierlinie
Allgemein
Klimakrise und Lebensweise
Studie von Dr. Andreas Weber im Auftrag der GBW Wien
Allgemein
Kleine Kinder Küche
Bunt, herzhaft, süß – und voller Überraschungen. Unser Kinderkochbuch.
Allgemein
Abschied von Maria Christina Boidi
31.10.1941 - 20.11.2022 | Verabschiedung am 14. Dezember 2022
Allgemein
Führungsleitbild für eine Grüne Organisation
Das Führungsleitbild richtet sich an alle Organisationen, die ihre Mitglieder in ihrer Vielfalt erkennen möchten und Basisdemokratie und Führung...
Allgemein
Im Gedenken an Oswald Kuppelwieser
19.1.1947 - 14.7.2022
Allgemein
An der Gürtellinie. Studien zur Verkehrsberuhigung
Zukunftsmusik statt Verkehrslärm: die erste Studie „Verkehrsberuhigung Margaretengürtel“
Allgemein
Stimme – Zeitschrift der Initiative Minderheiten
Im Fokus der 120. Ausgabe der Stimme: 30 Jahre Bündnisse und Kompromisse im Kampf für Gerechtigkeit und Menschenrechte.
Allgemein
Eine Festschrift für Maria Cristina Boidi
„Si no luchas, estas perdida! Wenn du nicht kämpfst, bist du verloren!“